Anzeige
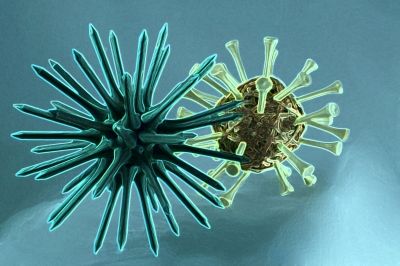
Mehr als lästige Krankmacher: Viren als nützliche Helfer
AIDS, Grippe und Herpes – all diese Krankheiten werden durch Viren verursacht. Doch die kleinen Partikel können durchaus auch nützlich sein: Wenn man mittels molekularbiologischer Techniken die Viren zu Genfähren umfunktioniert, kann man mit diesen sogenannten viralen Vektoren gezielt fremde Gene in Zellen einschleusen. Forschung, Gentherapie und Impfstoffe sind nur drei Gebiete, auf denen virale Vektoren zum Einsatz kommen.
Forschung
Aus der Forschung sind virale Vektoren kaum mehr wegzudenken. Zum erfolgreichen Einschleusen fremder Erbsubstanz in Zielzellen müssen virale Vektoren mehrere Eigenschaften erfüllen:
- Replikationsunfähigkeit: Damit sich das Virus nicht unkontrolliert im Zielorganismus vermehrt, ist es wichtig, dass dem Virus die Gene entfernt werden, die für eine Vermehrung notwendig sind. Hierbei kann es sich beispielsweise um die Gene handeln, die für den Bau der Virushülle notwendig sind.
- Hohe Spezifität: Ein Organismus besteht aus einer Vielzahl verschiedener Zelltypen. Oft möchten Wissenschaftler jedoch nur in einem einzigen Zelltyp etwas ändern. Das Virus muss daher in der Lage sein, Zelltypen zu unterscheiden und nur einen Zelltyp zu infizieren. Glücklicherweise sind viele Viren von Natur aus wählerisch, und diese Eigenschaft lässt sich mittels Gentechnik noch ausbauen.
- Kompatibilität: Nicht jeder Schlüssel passt in jedes Schloss, und nicht jedes Virus passt zu jedem Zelltyp. Daher ist es wichtig, dass der gewählte virale Vektor mit der Zielzelle kompatibel ist.
- Expression des Ziel-Gens: Als Genfähre ist es Aufgabe des viralen Vektors, ein Fremdgen in die Zielzelle einzubringen. Doch damit ist die Arbeit noch nicht getan: Das Fremdgen muss auch abgelesen und in RNA umgewandelt (transkribiert) werden. Und wenn es sich beim Fremdgen um die Bauanleitung für ein Protein handelt, muss diese Bauanleitung zusätzlich noch umgesetzt (translatiert) werden. Idealerweise lässt sich die Produktion des Proteins auch noch beliebig ein- und ausschalten.
Es gibt unterschiedliche Gründe dafür, warum man einen Gentransfer mittels viraler Vektoren durchführen will. Oft nutzen Forscher virale Vektoren dazu, ein bis dato unbekanntes Protein in großen Mengen herstellen, um anschließend Struktur und Funktion genauer unter die Lupe zu nehmen. Der Gewinn großer und reiner Mengen eines Proteins aus dem Gewebe, in dem das Protein natürlicherweise vorkommt, ist technisch schwierig und oftmals auch aus (tier-) ethischen Gründen unerwünscht. Eine elegante Lösung für dieses Problem ist die sogenannte heterologe Expression in Zellkulturen. Die durch virale Vektoren eingeschleuste Erbinformation bringt diese Zellkulturzellen dazu, ein ihnen fremdes Protein in großen Mengen herzustellen.
Alternativ kann man virale Vektoren aber auch dazu einsetzen, ein Gen gezielt abzuschalten. Bei diesem RNA interference (RNAi) genannten Prozess wird mithilfe des viralen Vektors Erbsubstanz in die Zelle eingebracht, die für eine sogenannte shRNA (short hairpin RNA) kodiert. Nachdem die Zelle die entsprechende shRNA hergestellt hat, spaltet ein Enzym namens Dicer die shRNA in ein Stück passender Größe, welches dann an einen Enzym-Komplex (RISC) bindet. Die Folge ist, dass dieser Enzym-Komplex die zelleigene RNA abbaut – das Gen ist effektiv stillgelegt, weil die Bauanleitung für das Protein zerstört wird. Mithilfe der RNAi lässt sich untersuchen, was geschieht, wenn man ein Gen funktionell ausschaltet. Dies wiederum lässt Rückschlüsse auf die Funktion im gesunden Organismus zu.
Manchmal ist es aber auch wichtig zu wissen, wie sich Zellen in einem Organismus entwickeln, ob und wie oft sie sich teilen, und wohin sie eventuell wandern. Mittels retroviraler Marker kann man Zellen kennzeichnen und verfolgen, und die Markierung bleibt auch nach einer Zellteilung bei den Tochterzellen bestehen. Ein gern verwendeter Marker ist das grün-fluoreszierende Protein (green fluorescent protein, GFP). Es stammt ursprünglich aus der biolumineszenten Qualle Aequorea victoria. Findige Wissenschaftler konnten das Gen, welches für das leuchtende Protein kodiert, aus der Qualle isolieren, und heute lassen sich damit beispielsweise einzelne Gehirnzellen markieren.
Gentherapie
Viele Krankheiten beruhen auf einem Defekt in einem einzigen Gen (monogene Erbkrankheit), von der eher harmlosen Farbenblindheit über Hämophilie (Bluterkrankheit) und Sichelzellanämie bis Mukoviszidose. Jeder Mensch erbt zwei Kopien seiner Gene: eine vom Vater und eine von der Mutter. Oft müssen beide Kopien des Gens defekt sein, damit die Krankheit ausbricht, doch bei manchen Krankheiten reicht bereits eine defekte Kopie aus, um zu erkranken.
Bisher können Erbkrankheiten nur symptomatisch behandelt werden. Könnte man jedoch eine oder gar beide defekte Kopien eines Gens gegen eine funktionstüchtige Variante austauschen, wäre die Erbkrankheit geheilt. Eine solche Therapie bezeichnet man als somatische Gentherapie, weil dabei nur die Körperzellen (somatischen Zellen) behandelt werden. Der Gendefekt kann über die Zellen der Keimbahn trotzdem weitervererbt werden.
Was in der Theorie einfach klingt, ist in der Praxis so schwierig, dass es in Deutschland bisher nur eine zugelassene Gentherapie gibt: Ende 2012 erteilte die EU-Kommission dem Medikament Glybera die Zulassung, welches Patienten von der seltenen Fettstoffwechsel-Krankheit Lipoprotein-Lipase-Mangel (LPLD) heilen soll. Glybera wurde von der niederländischen Biotech-Firma UniQure entwickelt, und die Markteinführung erfolgte in Kooperation mit dem italienischen Pharmakonzern Chiesi: Seit November 2014 ist das Medikament erhältlich, die gesamte Behandlung kostet rund 1,1 Millionen Euro.
Die meisten Gentherapien sind jedoch noch lange nicht soweit, sie befinden sich noch im Forschungs- und Entwicklungsstadium: Die Datenbank „Gene Therapy Clinical Trials Wordwide“ verzeichnete bis Juni 2014 2.076 klinische Studien zum Thema Gentherapie. Interessanterweise beschäftigten sich jedoch nur 9 Prozent dieser Studien mit einer monogenen Krankheit, 64 Prozent untersuchten dagegen den Effekt von Gentherapie auf die multifaktorielle Erkrankung Krebs.
Eine Gentherapie ist allerdings immer auch mit Risiken behaftet: Neben einer akuten Immunreaktion des Körpers auf die Viruspartikel, die sogar zum Tod führen kann, könnten die heilenden Gene auch versehentlich am falschen Platz im Erbgut eingebaut werden. Und so, wie eine an falscher Stelle eingefügte Seite ein schönes Buchkapitel zunichtemachen kann, so kann auch ein falsch eingebautes Gen drastische Konsequenzen haben: Krebs.
Impfung
Die genetische Impfung, auch Vektor-Impfung genannt, gehört bisher noch nicht zum Standard-Repertoire der Impfungen. Normalerweise werden bei einer Impfung Teile des Krankheitserregers wie Hüllproteine oder ganze, abgetötete Erreger (Totimpfstoff) injiziert. Alternativ können auch ganze, abgeschwächte Erreger (Lebendimpfstoff) verabreicht werden. Das Immunsystem reagiert, indem Zellen der angeborenen Abwehr (dendritische Zellen und Makrophagen) die Erreger aufnehmen, aufspalten und Bruchstücke an ihrer Oberfläche präsentieren. Diese Bruchstücke werden wiederum von Zellen der erworbenen Abwehr (T-Helferzellen) erkannt. Die T-Helferzellen regen dann sogenannte B-Lymphozyten dazu an, sich in eine B-Plasmazelle zu verwandeln und Antikörper gegen die Krankheitserreger zu bilden. Der ganze Prozess dauert etwa vier bis sieben Tage. Der Clou an dem System: Ein Teil der B-Lymphozyten verwandelt sich in B-Gedächtniszellen. Bei einem erneuten Kontakt mit dem Erreger können diese sofort mit der Antikörper-Produktion beginnen – man wird gar nicht erst krank, sondern ist immun.
Hinter der Vektor-Impfung steckt nun folgende Idee: Wenn man nun mittels viraler Vektoren Gensequenzen, die für Proteine eines Erregers kodieren (z.B. Hüllproteine), in eine Wirtszelle einschleust, wird diese Wirtszelle anfangen, das Erregerprotein zu bilden und an der Oberfläche zu präsentieren. Die Zellen der Immunabwehr erkennen diese Proteine als körperfremd, und leiten eine Immunantwort ein – ganz so, als wäre der Körper in Kontakt mit dem Krankheitserreger selbst gekommen, aber ohne die Risiken einer echten Infektion. Zurzeit laufen klinische Studien zu Vektor-Impfungen gegen HIV und Ebola.
Deutsche Firma ist internationaler Spitzenreiter
2007 in München von Dr. Christian Thirion gegründet, ist SIRION Biotech heute einer der führenden Anbieter viraler Vektoren mit Zweigstellen in Tokyo, New Hampshire und Tel Aviv. Die langjährige Erfahrung in über 300 Projekten für mehr als 70 industrielle und akademische Partner macht SIRION zum Experten für virenbasierte Vektorsysteme und individuell zugeschnittene Zellmodelle, und zum kompetenten Partner in der präklinischen Forschung.
Weitere Informationen
Autor: Dr. Annukka Aho-Ritter
medproduction, www.medproduction.de
Datum: Januar 2016
Quellen:
